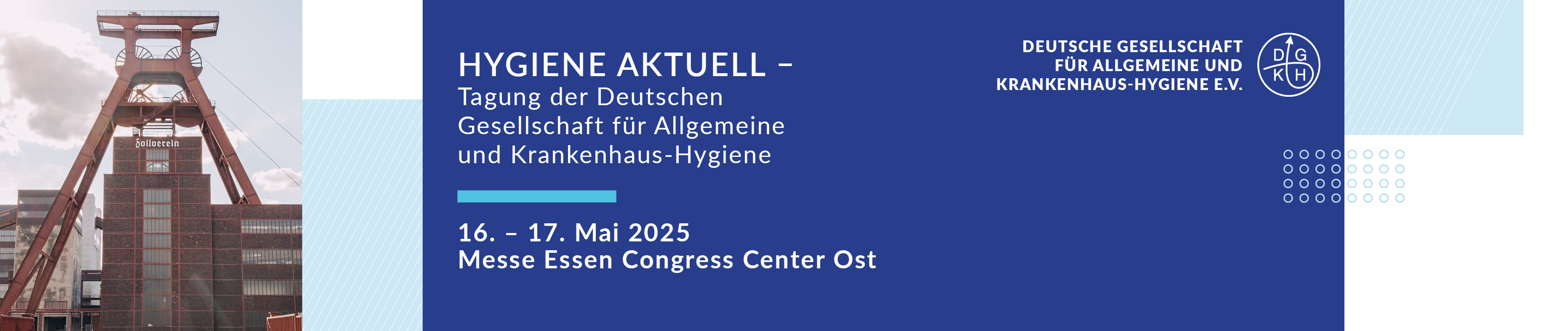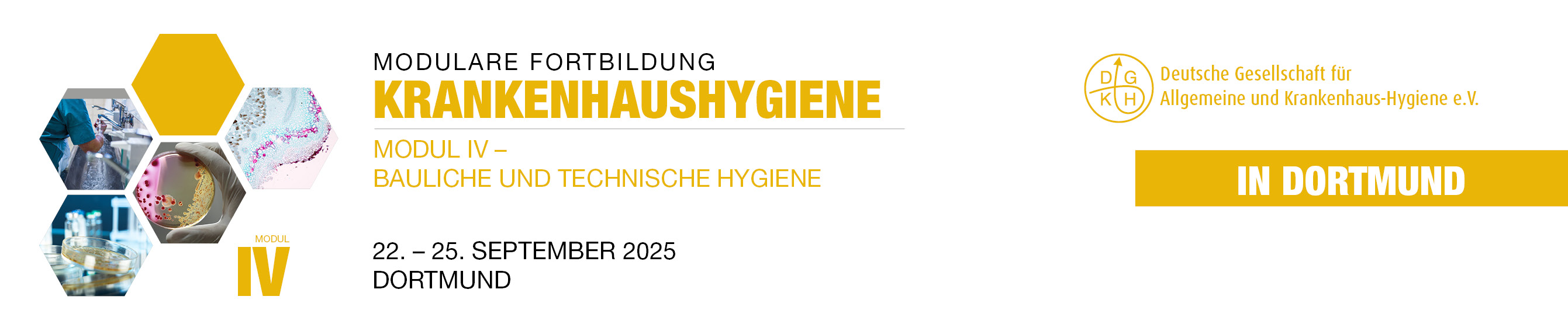Presseveröffentlichungen zum Thema Krankenhaushygiene
Erst waschen - In deutschen Kliniken grassieren gefährliche Keime. Sie töten jedes Jahr 1500 Menschen
Erst waschen
In deutschen Kliniken grassieren gefährliche Keime. Sie töten jedes Jahr 1500 Menschen
Von Cornelia Stolze
Als Klaus-Dieter Zastrow endlich von den Ärzten einer Berliner Klinik zu Hilfe gerufen wurde, war es schon zu spät. Zuerst hatten die Kollegen ihrem Patienten wegen einer hartnäckigen Entzündung einen Zeh amputiert – der Routine-Eingriff gelang. Doch dann eiterte die Wunde, sie hatte sich infiziert. Die verabreichten Antibiotika waren falsch, die Chirurgen hatten den Infektionsexperten nicht hinzugezogen. Der Erreger griff auf das ganze Bein über. Erst nach Monaten und immer neuen Teilamputationen, berichtet Zastrow, habe der Mann die Klinik endlich verlassen können – als Einbeiniger.
Arbeitsüberlastung, Ignoranz und Inkompetenz gefährden die Patienten
Ursache des Unglücks war eine Infektion mit einem berüchtigten Krankenhauskeim: Staphylococcus aureus; es war obendrein eine Antibiotika-resistente Variante der Mikrobe. Ein tragischer Einzelfall? Keineswegs, versichert Zastrow. Solche und minder schwere Vorfälle gehören inzwischen zum Alltag in deutschen Kliniken – und das bringt den Direktor des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin am Berliner Vivantes Klinikum Spandau auf die Palme. Seit Jahren zieht der Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene gegen gravierende Hygienemängel in deutschen Krankenhäusern zu Felde. Manch einer hat dem Funktionär daher schon vorgeworfen, Lobbyismus für seine Gesellschaft zu betreiben.
Doch glaubt man den Statistiken, dann sind Deutschlands Kliniken längst zu gefährlichen Bakteriennestern geworden. Schlamperei, Schlendrian trotz bestehender Hygienevorschriften, Inkompetenz, Ignoranz und Arbeitsüberlastung gefährden Leib und Leben der Patienten in den Kliniken. Über eine halbe Million Deutscher ziehen sich dort jedes Jahr verschiedene gefährliche Hospitalismus-Erreger zu. Dabei sei das eher zu tief gegriffen, betont Zastrow. »Ich sage, es sind eher 800000.«
Neuerdings, das zeigen jüngste Berichte von Forschern in Deutschland, Europa und den USA, breiten sich Antibiotika-resistente Keime nicht nur in den Zimmern und Fluren von Krankenhäusern aus. Nach aktuellen Studien im Fachblatt New England Journal of Medicine sind Infektionen mit den fatalen Erregern auch außerhalb von Kliniken auf dem Vormarsch. Erstmals sind US-Mediziner jetzt auf einen Typ von Krankenhauskeimen gestoßen, der viel aggressivere Entzündungen hervorruft, als man sie bislang gesehen hat. Von Fleisch fressenden Superbakterien ist die Rede, die in Deutschland aber noch nicht aufgetreten sind.
Seit neuestem hat Zastrow Rückendeckung von höchster Stelle. Auch die Seuchenwächter beim Robert-Koch-Institut (RKI) schlagen Alarm. Sorge bereitet der Berliner Behörde, die bundesweit für die Überwachung übertragbarer Krankheiten zuständig ist, vor allem die drastische Zunahme Methicillin-resistenter Stämme von Staphylococcus aureus, im Fachjargon MRSA genannt. Methicillin ist ein Antibiotikum. Wenn eine Staphylokokke gegen dieses Mittel immun ist, greifen auch fast alle anderen Antibiotika nicht mehr. »Noch vor 15 Jahren waren in Deutschland weniger als zwei Prozent dieser Keime in den Krankenhäusern gegen herkömmliche Antibiotika resistent«, sagt Wolfgang Witte, Leiter des Nationalen Referenzzentrums für Staphylokokken, einer Außenstelle des RKI in Wernigerode. Inzwischen, versichert der Experte, seien es mehr als 20 Prozent. »MRSA ist in Deutschland ein infektiologisches Problem ersten Ranges.«
Bereits heute, schätzen Forscher, ziehen sich hierzulande 40000 bis 50000 Patienten pro Jahr MRSA-Infektionen zu, 1500 von ihnen kostet die Bazille das Leben. Und selbst das, meint Zastrow, sei wohl zu wenig. »Viele Schwerkranke oder Sterbende werden ja gar nicht als MRSA-Patienten wahrgenommen. Welche Klinik will derartige Fälle denn schon freiwillig melden?«
Dabei ist das Problem lange bekannt: Staphylococcus aureus hat seit Jahrzehnten als eine der Hauptursachen von nosokomialen, also im Krankenhaus erworbenen Infektionen einen sehr schlechten Ruf. Das Bakterium ist bei vielen Gesunden als harmloser Parasit auf der Haut und in der Nase zu finden. Einem intakten Immunsystem kann es nichts anhaben.
Die Industrie verliert das Interesse an der Entwicklung neuer Antibiotika
Bei schwerkranken, immungeschwächten Patienten oder frisch Operierten dagegen hat es leichtes Spiel. Je nachdem, wie und wo sein Opfer geschwächt ist, verursacht es Haut-, Knochen- und Lungenentzündungen sowie eitrige Abszesse. Kommt es richtig schlimm, erkranken die Infizierten an Sepsis: Die Blutvergiftung tötet vier von zehn Betroffenen.
Dank einer Vielzahl potenter Antibiotika hatten Mediziner lange Zeit scharfe Waffen gegen diesen und andere Krankenhauskeime in der Hand. Allerdings trug ausgerechnet der Siegeszug dieser Medikamente maßgeblich dazu bei, dass die Mittel heute immer häufiger versagen. Denn im Kampf mit dem Gegner entstehen immer neue, gefährlichere Erreger: Je verschwenderischer und sorgloser Antibiotika eingesetzt werden, desto stärker ist der Druck auf die Mikroben, sich gegen die Angriffe zu wappnen. Getreu dem Darwinschen survival of the fittest überleben auf Dauer nur solche Keime die Pharma-Angriffe, die über Resistenzen verfügen, um den Wirkmechanismus der Medikamente auszuhebeln.
Zudem mangelt es an neuen Antibiotika, die Ärzte in Notfällen als Reservemittel gegen resistente Erreger einsetzen können. In den vergangenen zehn Jahren hat kaum eine Pharma-Firma in die Entwicklung neuer Bakterienkiller investiert. Zu gering sind die Aussichten, dass ein innovatives Antibiotikum zum Blockbuster wird und wenigstens eine Milliarde Dollar in ihre Kassen spült.
Saubere Kliniken in den Niederlanden, Bakteriennester in Großbritannien
Nötig wären sie gleichwohl. Erst kürzlich hat ein niederländisches Wissenschaftlerteam um Herman Goossens von der Universität Leiden erneut belegt, wie eng der Zusammenhang zwischen Antibiotika-Einsatz und Resistenzen ist. In ihrer im Fachblatt The Lancet veröffentlichten Studie hatten die Forscher die Verschreibungspraxis in 26 Ländern Europas in der Zeit zwischen 1997 und 2002 untersucht und waren dabei auf erhebliche Unterschiede gestoßen: Während Mediziner der nordischen Nationen mit den Antibiotika äußerst sparsam umgingen, waren ihre Kollegen im Süden Europas erheblich großzügiger. Spitzenreiter ist Frankreich. Dort verordneten die Ärzte dreimal so viel Antibiotika pro 1000 Einwohner wie in dem Land mit der niedrigsten Verschreibungsrate, den Niederlanden.
Und genau diese beiden Nationen weisen auch den größten Unterschied in der Verbreitung resistenter Keime auf. Fast die Hälfte aller Streptokokken in den Proben von französischen Patienten waren unempfindlich gegen Penicillin. In denen der Niederländer dagegen fanden sich so gut wie keine resistenten Erreger. Einen ähnlich klaren Zusammenhang gibt es auch bei den Vielverschreibern Spanien, Portugal, Ungarn und Slowenien auf der einen und den zurückhaltenderen Dänen, Schweden und Finnen auf der anderen Seite. Kaum verwunderlich, dass die Niederländer und Skandinavier die geringsten Probleme mit MRSA haben. Entgegen dem weltweiten Trend gelingt es allen vier Ländern seit Jahren, den Anteil Methicillin-resistenter Staphylokokken unter zwei Prozent zu halten.
Nur einen Ausreißer gibt es in diesem Nord-Süd-Gefälle: Großbritannien. In keinem anderen Land Europas hat sich MRSA so stark ausgebreitet. Heute sind 44 Prozent der Keime in britischen Krankenhäusern gegen herkömmliche Antibiotika resistent. In der Fachwelt, klagen die Klinikmediziner Albert Lansing und Robin Loveland im Lancet, gelte das Land inzwischen »bei manchen als der dreckige Mann Europas«. Eine Entwicklung, die Experten unter anderem auf die rigorose Sparpolitik Maggie Thatchers und den seither herrschenden Personalmangel im britischen Gesundheitssystem zurückführen. Die Angst vor den wehrhaften Bazillen greift inzwischen so um sich, dass manche Patienten in Großbritannien sich lieber erst gar nicht behandeln lassen, um nachher nicht noch kränker aus der Klinik herauszukommen, als sie hineingegangen sind.
Solche Zustände drohten indessen bald auch hierzulande, warnt RKI-Forscher Witte. »Wenn es uns nicht gelingt, die Verbreitung Antibiotika-resistenter Keime einzudämmen, haben wir bald so schlimme Verhältnisse wie in Großbritannien.« Die Schuldigen hat man beim RKI bereits geortet, Anfang Februar rüffelte das Amt im Epidemiologischen Bulletin die Ärzteschaft. Von Antibiotika-Einsatz mit Sinn und Verstand könne in Deutschland nicht die Rede sein, geben die Fachleute dort zu Protokoll. »Nicht in allen Einrichtungen erfolgt die Indikation und Auswahl von Antibiotika mit der gleichen Fachkompetenz.« Viele Ärzte in Deutschland verabreichen Antibiotika bei Erkrankungen, bei denen sie nicht helfen – oder aber sie verordnen schlichtweg die falschen Präparate.
Das Erfolgsgeheimnis der Dänen und Niederländer besteht für Witte und seine Kollegen aber nicht allein im sparsamen Umgang mit Antibiotika. Um einen künftigen Resistenz-GAU zu verhindern, seien drastischere Maßnahmen angezeigt. Bei jedem noch so kleinen Verdacht einer Infektion mit MRSA sollten Patienten strikt isoliert werden – ganz so, wie es die Niederlande und Dänemark seit Jahren vormachen.
Deutsche Patienten müssen im Ausland zunächst in die Quarantäne
Ob zum Blutdruckmessen oder Katheterwechseln – wann immer eine Krankenschwester in den Niederlanden das Zimmer eines Patienten mit MRSA-Keimen betritt, wappnet sie sich mit Schutzkleidung, Maske und Einmalhandschuhen. Mit Argusaugen betrachten niederländische Klinikärzte vor allem Kranke aus dem Ausland. Wer sich als Deutscher in den Niederlanden behandeln lassen will, muss erst einen Wangenabstrich für einen MRSA-Test erdulden und wird so lange isoliert, bis das Ergebnis vorliegt. »Search and destroy« nennen die Niederländer ihre Nulltoleranzpolitik gegenüber den resistenten Keimen, mit der sie systematisch nach dem Erreger suchen und ihn radikal ausrotten, sobald er irgendwo auftaucht. »Die strikte Isolierung und damit verbundene Stigmatisierung ist für manch einen Patienten regelrecht traumatisierend«, räumt der Mediziner Herman Goossens von der Universität Leiden ein.
Auch Ärzte und Schwestern müssen in den Niederlanden regelmäßig zum MRSA-Test. Ist der Befund »positiv«, müssen sie so lange zu Hause bleiben und Antibiotika einnehmen, bis sie »saniert« sind. Mitunter dürfen die Betroffenen erst wieder arbeiten, nachdem die Rachenmandeln – oft ein hartnäckiges Bakterienreservoir – herausoperiert wurden.
Ob solch drakonische Strategien tatsächlich nötig sind, ist indessen umstritten. Gleich zwei Forscherteams kommen in ihren Studien zu dem Schluss, dass die rigorose Isolation von Patienten mit MRSA-Erregern keineswegs besseren Schutz bietet als konventionelle Maßnahmen. Die Befunde beflügeln den Widerstand einer Gruppe deutscher Krankenhaushygieniker, die den Sinn dieser Maßnahme bezweifeln – und deshalb seit Jahren mit dem RKI im Clinch liegen. »Statt sich hysterisch auf MRSA zu fixieren«, sagt etwa die Medizinprofessorin Ines Kappstein vom Münchner Klinikum rechts der Isar, »müssten sich die Ärzte darum kümmern, den an vielen deutschen Kliniken verbreiteten hygienischen Schlendrian zu beseitigen und die Verbreitung von Krankenhauskeimen systematisch zu überwachen. Seit Jahrzehnten wissen wir, dass die einfachsten Regeln der Hygiene zum Teil massiv vernachlässigt werden.«
Der wichtigste Übertragungsweg, darin sind sich Kappstein und andere Experten einig, sind die Hände des medizinischen Personals. Mangelnde Ausbildung, Überlastung und fehlende Motivation durch die Vorgesetzten führen dazu, dass Ärzte, Schwestern oder Pfleger infektiöse Keime von einem Patienten zum anderen schleppen, mit unsauberen Instrumenten hantieren oder trotz Einmalhandschuhen auf Kitteln, Pflegeartikeln und Geräten Krankheitserreger hinterlassen. Dort bleiben sie über Monate hinweg lebens- und infektionsfähig.
Die beste Gegenmaßnahme ist konsequente Desinfektion. Wie die in der Praxis aussehen muss, scheinen aber selbst viele Profis nicht so recht zu wissen. Eine amerikanische Studie legte im Jahr 2000 die hygienische Schlamperei in USKliniken bloß: In 83 Prozent der Fälle wuschen sich die Ärzte und Pfleger nach dem Kontakt mit abgeschirmten Patienten die Hände aber niemals, bevor sie den Isolierraum betraten. »Das Krankenhauspersonal empfand das Waschen offenbar eher als persönlichen Schutz denn als Vorsichtsmaßnahme für den Patienten«, stellten die Autoren damals trocken fest.
Mangelnde Händehygiene ist besonders bei männlichen Ärzten verbreitet. Klaus-Dieter Zastrow erlebte die hygienische Ignoranz selbst ganz oben in der Hierarchie. Als er eine Klinik aufgefordert hatte, endlich einen Oberarzt zur Ausbildung als Hygienebeauftragten abzustellen, war er gescheitert. »Da hat der Chefarzt mir tatsächlich gesagt: ›Für Hygiene haben wir keine Zeit.‹«
(c) DIE ZEIT 21.04.2005 Nr.17